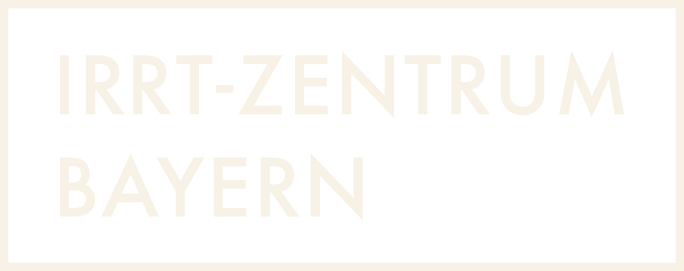Über die IRRT
Die Methode wurde in ihren Grundzügen Anfang der 1990er Jahre als eine auf Imagination basierende Therapiemethode zur Behandlung von Traumafolgestörungen von Prof. Dr. Mervyn Schmucker in den USA entwickelt.
Seit 2012 wurde die IRRT in Zusammenarbeit mit Dr. Rolf Köster angepasst, verfeinert, in ihrem Anwendungsspektrum deutlich erweitert und kann heute auf sämtliche belastungsabhängige psychische Störungen, insbesondere Angststörungen, Depressionen, Trauerreaktionen und auch Persönlichkeitsstörungen angewendet werden. Neuere Entwicklungen ermöglichen die Behandlung von Suchterkrankungen und anderen selbstschädigenden Verhaltensweisen.
IRRT ermöglicht eine schonende Bearbeitung der belastenden Bilder, Blockaden und Schemata. Ursprünglich aus der kognitiven Verhaltenstherapie entwickelt, lässt sich IRRT gut in verhaltenstherapeutische, psychodynamische, systemische, humanistische sowie andere therapeutische Vorgehensweisen integrieren.
Eine IRRT-Sitzung verläuft in der Regel in drei Phasen:
Phase I
Das Wiedererleben in sensu und verbalisieren belastender Bilder und assoziierter Emotionen des Traumas.
Phase II
Die Konfrontation und Entmachtung der Täterin / des Täters durch das aktuelle Ich der Patient*innen.
Phase III
Die Entwicklung von Bildern der Beruhigung, Tröstung und Versöhnung zwischen aktuellem Ich und traumatisiertem Ich bzw. damaligen Ich / Kind-Ich.
Im Rahmen von Nachbesprechung und Hausaufgaben wird parallel an der Vertiefung und Verankerung des Erreichten und an der kognitiven Umstrukturierung gearbeitet.
Die IRRT zeichnet sich durch die folgenden Hauptaspekte in der Behandlung aus:
- die Arbeit in der Imagination auf der inneren Bühne der Patient*innen
- die sokratische Haltung der Therapeut*innen, d.h. eine inhaltlich offene, fragende und paraphrasierende Haltung. Es wird lediglich der formale Rahmen der Imagination vorgegeben und die Patient*innen „auf Kurs“ gehalten. Die inhaltliche Gestaltung des Prozesses ist Aufgabe der Patient*nnen, welche selbst wissend sind. Die Therapeut*innen helfen lediglich dabei, dieses Wissen zu entdecken
- die Arbeit mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen als Protagonist*innen auf der inneren Bühne der Patient*innen. Die Wichtigsten sind dabei das damalige Ich/Kind-Ich, das aktuelle Ich sowie die TäterIn bzw. das TäterInbild
- die Betonung von Nuancen in der sprachlichen Formulierung der Fragen und Aussagen der Therapeut*innen. In der Regel werden offene, statt geschlossene Fragen gestellt. Durch geschicktes Formulieren, z.B. Verwendung des Konjunktivs oder die Formulierung eines Handlungswunsches vor der eigentlichen Handlung können auch schwierige Entwicklungsschritte für die Patient*innen ermöglicht werden